SMALL MODULAR REACTORS (SMR): KERNKRAFTWERKE VOM FLIESSBAND
—— Kleiner, günstiger, sicherer. Das versprechen diverse Projekte die Mini-Kernkraftwerke in Serie bauen wollen. Steht eine Renaissance der Kernkraft im Kleinformat bevor?
Es war das Jahr 1665, als der dänische Anatom Nicolaus Steno die These formulierte, dass unser Gehirn wie eine Maschine funktioniere. Um seine Tätigkeit und Funktionsweise zu verstehen, müsse man es auch als solche betrachten und auseinandernehmen, fand er. Seit mehr als 350 Jahren befolgen wir nun Stenos Rat. Wir schauen in tote Gehirne, entfernen Teile von lebenden, zeichnen die elektrische Aktivität von Nervenzellen auf und verändern neuerdings sogar die neuronale Funktion – mit erstaunlichen Folgen.
In Tierversuchen können wir eine Maus dazu bringen, sich an einen Geruch zu erinnern, dem sie nie zuvor begegnet ist. Bei manchen Tierarten können wir die Struktur des Gehirns und somit das Verhalten des Tiers beinahe nach Belieben ändern. Wir sind sogar fähig, einen gelähmten Menschen in die Lage zu versetzen, mithilfe von Geisteskraft einen Roboterarm zu steuern. Und doch haben wir noch immer keine klare Vorstellung davon, wie Milliarden, Millionen, Tausende oder selbst nur Dutzende von Neuronen im Hirn genau zusammenwirken.
Wir wissen in groben Zügen, was vor sich geht: Das Gehirn versendet Reize über neuronale Netze. So interagiert es mit seiner Umwelt und unserem Körper. Es prognostiziert mögliche Veränderungen dieser Reize, um reaktionsbereit zu sein, und es steuert als Teil des menschlichen Körpers dessen Handeln. All das wird durch Nervenzellen – also Neuronen – erreicht, die auf komplexe Weise miteinander verbunden sind. Und durch die Chemikalien, in denen diese Netzwerke baden.
Wenn es aber darum geht, tatsächlich zu verstehen, was in einem Gehirn wirklich geschieht, oder darum, sogar vorhersagen zu können, was passiert, wenn die Aktivität eines bestimmten Netzwerks verändert wird, dann stehen wir noch im-mer ganz am Anfang.
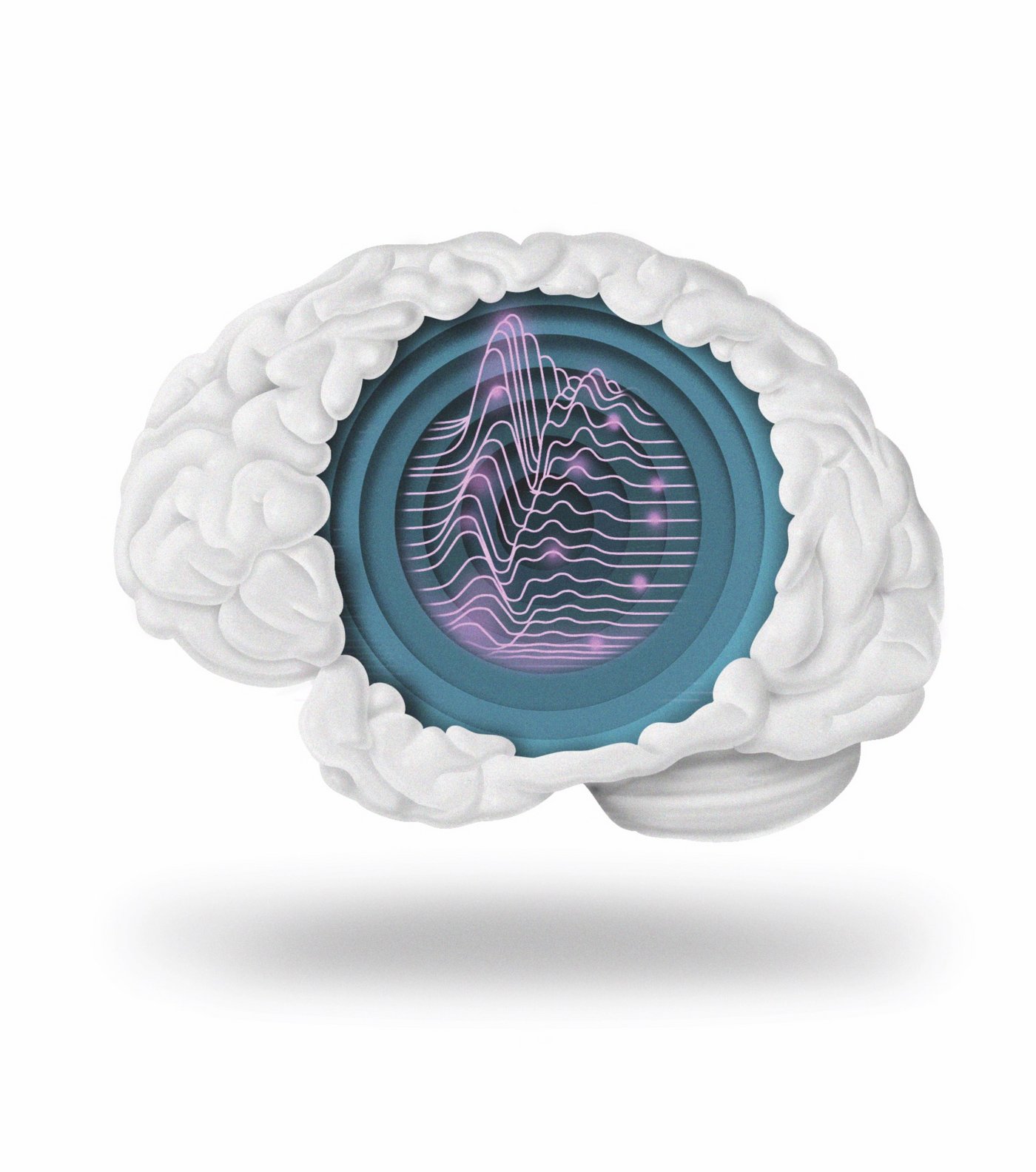
Eine Erklärung, warum die Forschung zwar riesige Fortschritte macht, aber vielen Fragen immer noch ratlos gegenübersteht, geht auf Nicolaus Stenos These, das Gehirn als Maschine zu betrachten, zurück. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Vorstellung von einer „Maschine“ immer wieder stark gewandelt – und jede davon hatte wiederum Konsequenzen für unsere Vorstellung vom Gehirn.
Als Steno seine These formulierte, wurden Maschinen noch durch Hydraulik oder Uhrwerke angetrieben. Die Erkenntnisse, die sich aus dieser Metapher ableiten ließen, waren begrenzt und schnell überholt. Im 19. Jahrhundert wurde das Gehirn dann erst als Telegrafennetz und später als Telefonzentrale betrachtet. Als flexible Organisation also, die einen ebenso flexiblen Output ermöglicht. Seit den 1950er-Jahren dominieren Begriffe der Informatik unsere Vorstellung vom Gehirn: Feedback-Loops, Informationen, Codes, Berechnungen.
Die Wissenschaftler, die als Erste die Parallele zwischen Gehirn und Computer zogen, erkannten allerdings rasch, dass Gehirne nicht digital sind. Nicht einmal das einfachste Tiergehirn gleicht einem Computer, wie ihn Menschen bauen. Das Gehirn ist kein Computer – aber es ähnelt ihm eher als einem Uhrwerk. Indem wir also über Parallelen zwischen Computern und Gehirnen nachdenken, können wir Erkenntnisse darüber gewinnen, was in unseren Köpfen – und in denen von Tieren – vor sich geht.
Über die Jahrhunderte hat jede neue technologische Metapher unser Verständnis des Gehirns erweitert und uns in die Lage versetzt, neue Experimente durchzuführen und mit ihnen alte Erkenntnisse zu überdenken. Gleichzeitig schränken Metaphern unser Denken naturgemäß ein. Einige Wissenschaftler haben inzwischen etwa realisiert, dass unsere Vorstellung vom Gehirn als passivem Computer, der ausschließlich auf Input reagiert und Daten verarbeitet, zu kurz greift. Sie ignoriert die Tatsache, dass unser Gehirn ein aktives Organ ist, ein Teil eines Körpers also, der in seine Umwelt eingreift und eine evolutionäre Vergangenheit besitzt, die seine Struktur und Funktion prägt. Durch die Metapher des Computers verlieren wir elementare Tätigkeiten des Gehirns aus dem Blick. Metaphern formen unser Denken in einer Weise, die nicht immer hilfreich ist.

Eine verlockende Schlussfolgerung der Geschichte lautet, dass sich unsere Ideen vom Gehirn auch in Zukunft automatisch erweitern, sobald es neue technologische Entwicklungen gibt. Dass wir unsere gegenwärtigen Gewissheiten erneut interpretieren, falsche Annahmen verwerfen und neue Theorien und Verständnisweisen entwickeln. Wenn Wissenschaftler dann erkennen, dass ihre Denkweise – einschließlich der Fragen, die sie stellen, und der Experimente, die sie sich vorstellen – zum Teil durch technologische Metaphern begrenzt ist, werden sie oft nervös und wollen wissen, was die nächste große Entdeckung sein könnte und wie sie sie für ihre Forschung anwenden können.
In der Geschichte der menschlichen Vorstellung des Gehirns gibt es immer wiederkehrende Themen und Argumente, von denen einige immer noch heftige Debatten provozieren. Ein strittiger Punkt ist, wie sehr Funktionen des Gehirns bestimmten Bereichen zugeordnet werden können. Es geht dabei um eine Vorstellung, die Tausende Jahre zurückreicht. Bis heute wird behauptet, einzelne Bereiche des Gehirns seien für bestimmte Dinge verantwortlich, etwa für das Gefühl in der Hand, für die Fähigkeit, Satzbau zu verstehen oder für die Selbstkontrolle.
Die These wurde häufig relativiert, weil man entdeckt hat, dass die betreffende Aktivität auch durch andere Teile des Gehirns beeinflusst oder vervollständigt wird und die untersuchte Gehirnregion auch an anderen Prozessen beteiligt ist. Mit diesem Wissen war die Idee der Lokalisierung zwar noch nicht direkt widerlegt, aber doch deutlich abgemildert.
Der Grund dafür ist einfach: Anders als Maschinen wurden Gehirne nicht vom Menschen konstruiert. Sie sind Organe, die sich im Laufe von mehr als fünf Millionen Jahren entwickelt haben. Es gibt also wenig oder gar keinen Grund zu glauben, dass sie so wie vom Menschen geschaffene Maschinen funktionieren würden.
Einige Forscher befürchten womöglich deswegen, dass wir mit unserem Verständnis des Gehirns in einer Sackgasse stecken. Wir hören zwar tagtäglich von neuen Entdeckungen, die Licht in die Funktionsweise des Gehirns bringen sollen und werden mit Verheißungen (oder Androhungen) neuer Technologien konfrontiert, die uns befähigen sollen, so abwegige Dinge zu tun wie Gedanken zu lesen, Verbrecher zu erkennen oder unser Selbst in einen Computer hochladen zu lassen. Doch im Gegensatz zu diesen überschwänglich anmutenden Theo--
rien haben einige Neurowissenschaftler das Gefühl, dass unser zukünftiger Weg keineswegs so klar ist. Es ist also gar nicht so einfach zu erkennen, was wir tun sollen – außer Daten zu sammeln oder neue experimentelle Ansätze auszuprobieren.
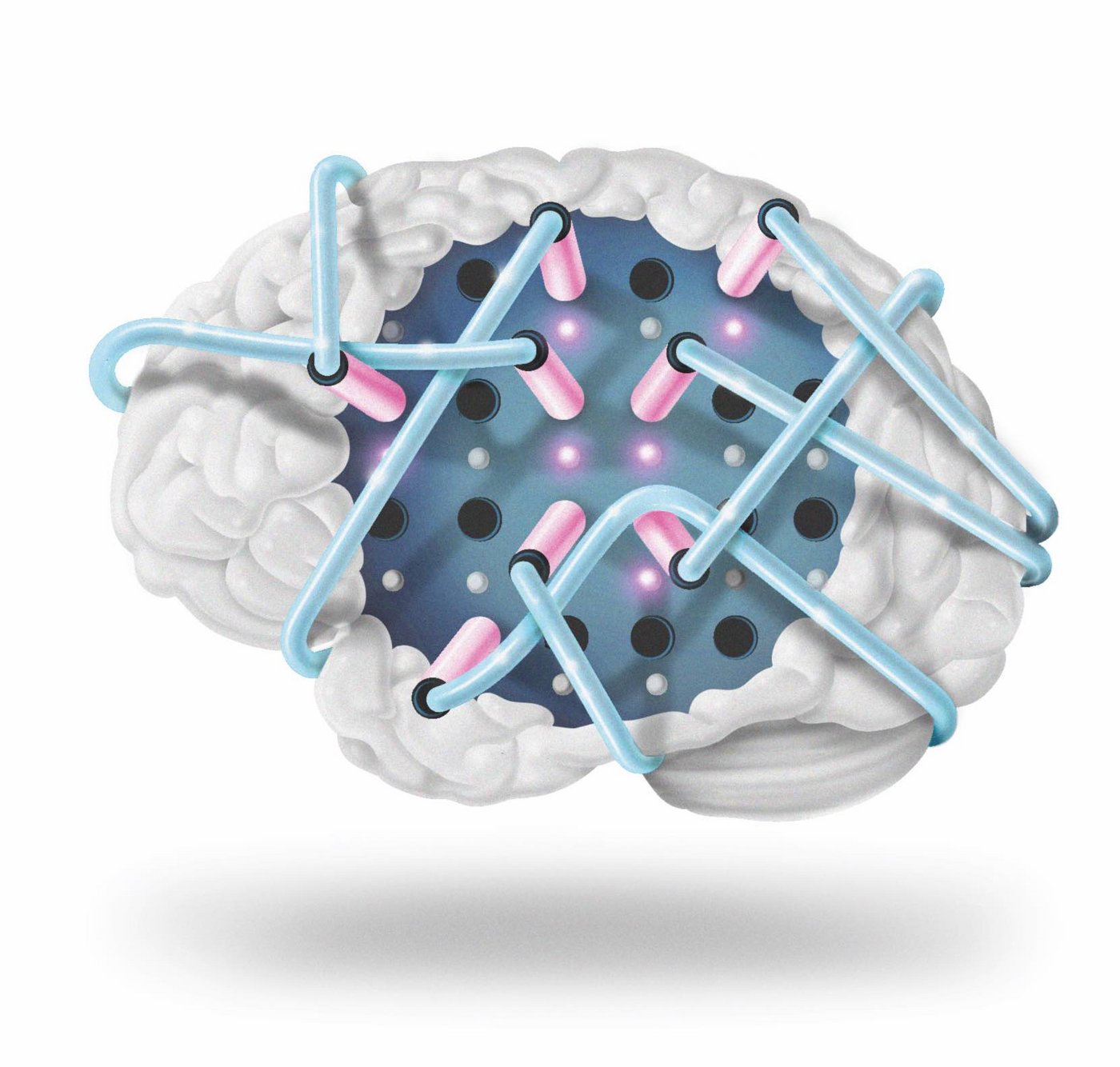
Das alles bedeutet nicht, dass sich überall Pessimismus breitmacht. Einige Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass uns neue mathematische Methoden bald erlauben werden, die unzähligen Verschaltungen des menschlichen Gehirns besser zu verstehen. Andere (wie ich selbst) ziehen es vor, Tiere am anderen Ende der Skala zu studieren und die Aufmerksamkeit auf die winzigen Gehirne von Würmern oder Maden zu richten. Mit diesem bewährten Ansatz versuchen wir zu verstehen, wie ein einfaches System funktioniert, um diese Erkenntnisse dann auf komplexere Fälle anzuwenden.
Viele Neurowissenschaftler gehen auch, wenn sie überhaupt über das Problem nachdenken, davon aus, dass der Fortschritt Stückwerk bleibt und nur langsam voranschreiten wird, weil sich schlicht noch keine große, einheitliche Theorie des Gehirns am Horizont abzeichnet.
Zwei Punkte verdeutlichen das Problem: Erstens ist das Gehirn unglaublich kompliziert. Jedes Gehirn, nicht nur das menschliche, auf das sich ein Großteil der bisherigen Forschung konzentriert hat, ist das komplexeste Objekt im bekannten Universum. Zweitens wissen wir trotz Bergen hirnbezogener Daten, die von Laboratorien auf der ganzen Welt produziert werden, nicht genau, was wir mit all diesen Daten tun sollen. Uns fehlt die Idee, was sie in ihrer Gesamtheit bedeuten.

Beide Probleme zeigen, dass die Computermetapher, die uns über ein halbes Jahrhundert gut gedient hat, möglicherweise an ihre Grenzen stößt – genau wie die Idee vom Gehirn als Telegrafensystem, die sich im 19. Jahrhundert irgendwann erschöpfte.
Einige Wissenschaftler stellen nun die Nützlichkeit einiger der grundlegendsten Metaphern über das Gehirn und das Nervensystem infrage. Etwa die Idee, dass neuronale Netzwerke durch einen neuronalen Code die Außenwelt verkörpern. Gut möglich also, dass die Wissenschaft am Fundament der landläufigen metaphorischen Vorstellung von den Funktionsweisen des Gehirns kratzt. Ebenso könnte es sein, dass die Entwicklung der Informatik erneut unsere Sichtweise des Gehirns beeinflusst und der Computermetapher neues Leben einhauchen. Vor allem künstliche Intelligenz und neuronale Netze, die teilweise davon inspiriert sind, wie das Gehirn Dinge tut, spielen hier eine wichtige Rolle. Allerdings geben führende Forscher im Bereich Deep Learning, der derzeit angesagtesten und überraschendsten Spielform moderner Informatik, freimütig zu, dass sie nicht genau wissen, wie ihre Programme das tun, was sie tun. Insofern ist fraglich, ob uns die Computertechnologie wirklich Erklärungen liefern wird, wie das Gehirn funktioniert.
Der Traum, einmal das menschliche Gehirn mit seinen Milliarden Zellen zu verstehen und zu durchdringen, wie es einen menschlichen Geist erzeugt, mag mitunter unerreichbar erscheinen. Aber die Wissenschaft ist die einzige Methode, die dieses Ziel erreichen kann – und wird.
In der Vergangenheit gab es immer wieder Momente, in denen Hirnforscher nicht genau wussten, wie sie weiter vorgehen sollen. Als in den 1870er-Jahren die Telegrafenmetapher verblasste, kamen Zweifel auf, ob die Hirnforschung je das Geheimnis des Bewusstseins würde lösen können. 150 Jahre später verstehen wir immer noch nicht, wie Bewusstsein entsteht. Aber die Wissenschaft ist trotz aller Herausforderungen zuversichtlicher, dass es eines Tages möglich sein wird. Zu verstehen, wie Denker in der Vergangenheit darum gerungen haben, die Gehirnfunktion zu begreifen, ist ein wesentlicher Teil dessen, was wir jetzt tun müssen, um dieses Ziel in Zukunft zu erreichen.
Wir sollten unser heutiges Unwissen nicht als Niederlage begreifen, sondern als Herausforderung. Als Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit und Ressourcen auf das zu richten, was es zu entdecken gilt, und auf die Entwicklung von Forschungsprogrammen, die uns den Antworten näherbringen können. Einmal mehr zeigt sich, warum die vier wichtigsten Wörter in der Wissenschaft lauten: „Wir wissen es nicht.“